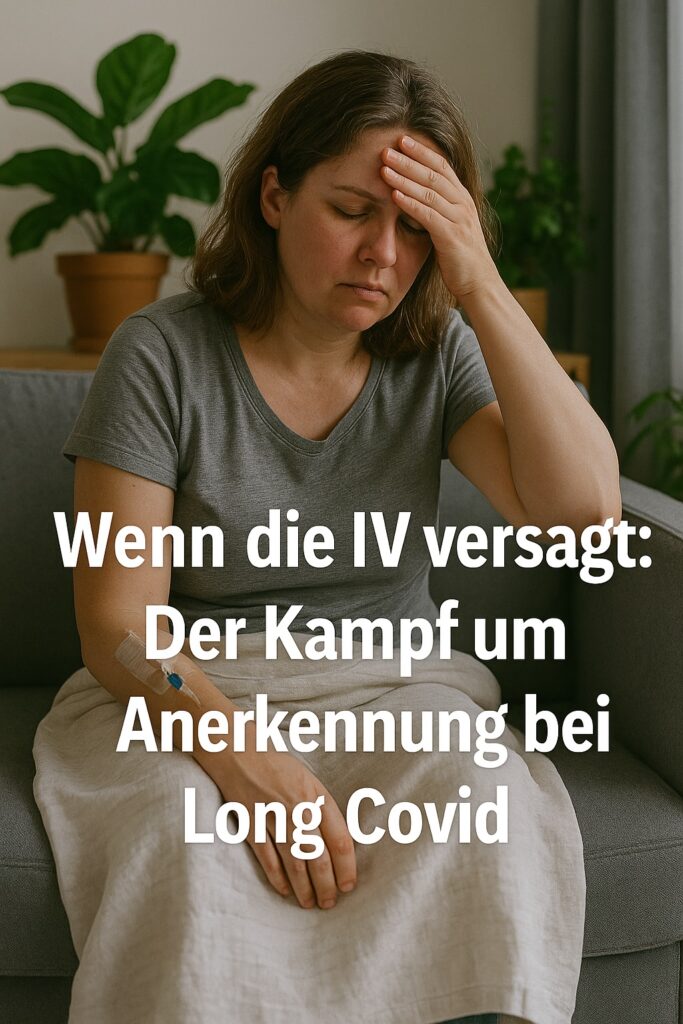
Quelle:SRF.ch
“Mit Long Covid oder dem schweren Verlauf der Krankheit, ME/CFS, haben Betroffene bei den IV-Gutachterstellen eigentlich schon verloren”, sagt Neurologin Maja Strasser aus Solothurn. Diese ernüchternde Einschätzung einer Fachärztin, die 160 Long Covid-Patienten betreut, offenbart ein systemisches Problem: Die Invalidenversicherung scheint auf eine der komplexesten Krankheiten unserer Zeit nicht vorbereitet zu sein.
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Von 5000 Menschen mit Long Covid, die sich bei der IV angemeldet haben, erhielten gerade mal rund vier Prozent eine Rente. Dabei unterscheidet die Behörde nicht einmal zwischen ganzen und halben Renten. Was auf den ersten Blick wie eine niedrige Quote erscheint, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als Hinweis auf fundamentale Probleme im System.
Neurologin Maja Strasser behandelt in ihrer Facharztpraxis sehr viele schwer kranke Patienten, doch keine Patientengruppe sei aufwendiger als diejenige mit Long Covid und ME/CFS. Das Krankheitsbild sei “wahnsinnig komplex”, die Begleitung der Patienten anspruchsvoll. Viele seien zu 100 Prozent arbeitsunfähig. Die IV hingegen habe “Mühe, das Krankheitsbild einzuordnen”. Die Gutachten, die sie bislang von ihren Patienten gesehen habe, seien mangelhaft und erfassten das Wesentliche nicht.
Gutachten ohne Verständnis
Die Kritik der Expertin ist vernichtend: “Noch nie habe ich ein Gutachten gesehen, das den zentralen Aspekt des schweren Krankheitsverlaufs – die Belastungsintoleranz – auch nur annähernd gewürdigt hat.” Gutachten, welche dieses für Patienten so limitierende Symptom nicht abbildeten, seien “nichts wert”. Eine krankhafte Erschöpfung und Belastungsintoleranz seien die zentralen Aspekte des schweren Krankheitsverlaufs. Würden Betroffene die Schwelle der Belastungsintoleranz überschreiten, komme es ein paar Tage später zu einem sogenannten Crash, einer teils massiven Symptomverschlechterung, die sogar irreversibel sein könne.
Stattdessen wende die IV häufig Depressionsfragebögen an, mit denen mögliche psychische Erkrankungen diagnostiziert werden könnten – völlig am Krankheitsbild vorbei. Gutachten für Betroffene von Long Covid und ME/CFS müssten Qualitätskriterien entsprechen, die sich am wissenschaftlichen Konsens orientieren. Dafür brauche es angepasste Fragebögen und Abklärungstools.
Das Problem liegt tiefer: Wie man seinem Arzt die Symptome richtig erklärt wird zu einer überlebenswichtigen Fähigkeit, wenn schon spezialisierte Gutachter das Krankheitsbild nicht verstehen. Die täglichen Entscheidungen, die Long Covid-Betroffene treffen müssen, bleiben für Außenstehende oft unsichtbar.
Jahre des Wartens
Die Verfahrensdauer ist ein weiteres gravierendes Problem. Manuela Bieri, Vorstandsmitglied von Long Covid Schweiz, berichtet: “Von der Anmeldung bis zu einem Entscheid dauere es viel zu lange. Allein auf einen Gutachtertermin warte man jahrelang.” Dass die positiven Rentenentscheide bis jetzt so gering ausfallen, ist für sie ein Zeichen dafür, “dass die meisten gesundgeschrieben werden”. Viele Mitglieder der Selbsthilfegruppe seien derzeit mit ihrem Gesuch in Revision.
Ein dramatisches Beispiel ist die 40-jährige Miriam Hürster. Das ehemalige Kadermitglied einer großen Versicherung ist gemäß Arztbericht schwer behindert. Bei ihr hat Long Covid den schweren Verlauf von ME/CFS genommen. Die Taggeldversicherung ist ausgelaufen, der Job wurde ihr gekündigt. Auf einen Gutachtertermin, geschweige denn auf einen Entscheid der IV, wartet sie seit über zwei Jahren vergeblich.
Die IV hat ihr im Herbst 2023 geschrieben, es bestehe derzeit ein “größerer Rückstau auf der Verteilplattform”. Wann ihr Dossier einer Gutachterstelle zugeteilt werden könne, sei “von den Kapazitäten der Gutachterstelle abhängig”. Für Miriam ist diese Ungewissheit besonders belastend: “Werde ich dereinst selbstbestimmt wohnen können?” Der IV-Entscheid sei zentral für andere Verfahren, und auch, ob andere Stellen Zahlungen leisten, hängt vom Entscheid der IV ab.
Systemversagen mit menschlichen Konsequenzen
Patientenanwalt Sebastian Lorentz kritisiert, dass durch teils sinnlose Mitwirkungspflichten das Verfahren in die Länge gezogen werde. Zum Beispiel für Therapien, die dem Krankheitsbild nicht gerecht würden. Die Idee des Sozialversicherungssystems sei eine ganz andere: “Ein einfaches Verfahren, das keine hohen Anforderungen stellt und den Betroffenen hilft.” Bei diesen IV-Verfahren werde “das hehre Ziel des Gesetzgebers aber nicht eingehalten”. Definitive Entscheide zu Long Covid seien in seiner Kanzlei rar. Er stelle fest: “Die IV hat Schwierigkeiten mit dem Krankheitsbild Long Covid.”
Das Resultat dieses Systemversagens zeigt sich besonders drastisch am Beispiel der 37-jährigen Nicole Spychiger. Ihr Jobausfall und die Krankheit haben das Vermögen der vierköpfigen Familie “weggefressen”. Eine Wiedereingliederung sei bei ihr nicht möglich, schrieb ihr die IV. Job und Taggeldversicherung hat sie seit Dezember 2023 nicht mehr. Nur dank einer Spendenaktion von Freunden kann sich die Familie über Wasser halten. Die IV hat ihr empfohlen, sich bei der Sozialhilfe zu melden.
“Ich dachte immer, wir seien gut versichert. Und dann fällst du längere Zeit aus, mit einer Krankheit, die neu und nicht nachweisbar ist, und du fällst überall runter”, schildert Nicole ihre Verzweiflung. Die Spendenaktion sei eine “Verzweiflungstat” gewesen. Hier wird deutlich, wie schnell Menschen aus der gesellschaftlichen Mitte in die Armut abrutschen können, wenn das Sicherheitsnetz versagt.
Nicoles Fall ist symptomatisch für ein grundsätzliches Problem: Die IV scheint nicht darauf vorbereitet zu sein, mit neuen, komplexen Krankheitsbildern umzugehen. Während bei klassischen Behinderungen oft klare medizinische Parameter existieren, bewegt sich Long Covid in einem Graubereich, der die bestehenden Bewertungsraster sprengt. Die Folge: Betroffene fallen durch alle Maschen des sozialen Netzes.
Hier zeigt sich, wie die harte Realität zwischen medizinischer Wahrheit und bürokratischen Hürden aussieht. Die Kluft zwischen dem, was Mediziner als Realität anerkennen, und dem, was die Bürokratie bereit ist zu akzeptieren, wird immer größer. Betroffene sind gefangen zwischen diesen Welten und tragen die Konsequenzen dieser Diskrepanz.
Ein System, das Betroffene im Stich lässt
Die Erfahrungen dieser Betroffenen sind keine Einzelfälle. Wenn die IV nicht zahlt, stehen Menschen wie Marco vor dem Nichts. Seine persönliche Geschichte zeigt exemplarisch, wie ein System, das eigentlich als Sicherheitsnetz gedacht ist, Betroffene in existenzielle Not stürzen kann.
Marcos Fall verdeutlicht die Absurdität der Situation: Ein Mann, der jahrzehntelang gearbeitet und in die Sozialversicherungen eingezahlt hat, wird plötzlich als “nicht krank genug” eingestuft, obwohl er kaum noch das Haus verlassen kann. Die Bürokratie verlangt Nachweise für Symptome, die per Definition schwer messbar sind. Wie soll man Erschöpfung quantifizieren? Wie beweist man kognitive Einschränkungen, die von Tag zu Tag schwanken?
Die Probleme sind vielschichtig und systematisch: Überlange Verfahren, Unterstellungen von psychischen Krankheiten und Gutachten, die das Krankheitsbild nicht annähernd erfassen. Dazu kommen überlastete polydisziplinäre Gutachterstellen und ein grundsätzliches Unverständnis für die Komplexität von Long Covid und ME/CFS. Die IV operiert mit veralteten Konzepten von Krankheit und Behinderung, die den Realitäten des 21. Jahrhunderts nicht mehr gerecht werden.
Besonders problematisch ist die Tendenz, körperliche Symptome zu psychologisieren. Viele Betroffene berichten, dass ihre Beschwerden als Depression oder Angststörung abgetan werden. Diese Fehlinterpretation hat schwerwiegende Konsequenzen: Statt angemessener medizinischer Behandlung erhalten sie Empfehlungen für Psychotherapie oder gar die Unterstellung, sie seien arbeitsscheu.
Die Neurologin Maja Strasser bringt es auf den Punkt: “Die Gutachter verstehen die Krankheit in den meisten Fällen nicht.” Diese Unwissenheit ist nicht nur unprofessionell, sondern auch gefährlich. Falsche Einschätzungen können den Gesundheitszustand der Betroffenen verschlechtern, wenn ihnen Aktivitäten empfohlen werden, die ihrem Zustand schaden.
Das Verständnis und die Bewältigung von Long Covid erfordern nicht nur medizinische Expertise, sondern auch ein Umdenken in den sozialen Sicherungssystemen. ME/CFS, kurz erklärt, verdeutlicht die Komplexität einer Erkrankung, die das gesamte System herausfordert. Es handelt sich um eine Multisystemerkrankung, die verschiedene Organe und Körperfunktionen betrifft – von der Immunabwehr über das Nervensystem bis hin zum Stoffwechsel.
Die menschliche Dimension
Hinter jeder Statistik stehen Menschen mit zerbrochenen Lebensplänen. Menschen, die vor ihrer Erkrankung produktive Mitglieder der Gesellschaft waren und nun um ihre Existenz kämpfen müssen. Persönliche Geschichten zeigen die ganze Bandbreite der Erfahrungen – von der ersten Infektion über die lange Odyssee der Diagnosestellung bis hin zum zermürbenden Kampf um Anerkennung.
Die psychischen Auswirkungen dieser Odyssee sind verheerend. Viele Betroffene entwickeln zusätzlich zu ihrer körperlichen Erkrankung Depressionen oder Angststörungen – nicht als Ursache ihrer Long Covid-Symptome, sondern als direkte Folge der jahrelangen Kämpfe mit Behörden, Ärzten und Versicherungen. Sie erleben eine doppelte Viktimisierung: Erst macht sie die Krankheit arbeitsunfähig, dann lässt sie das System im Stich.
Besonders tragisch ist die Situation von Familien mit Kindern. Nicole Spychigers vierköpfige Familie ist nur ein Beispiel dafür, wie Long Covid ganze Familiensysteme destabilisieren kann. Die Kinder erleben, wie ihre Eltern um die Existenz kämpfen, wie das gewohnte Leben zusammenbricht und Unsicherheit den Alltag bestimmt. Die langfristigen Auswirkungen auf die nächste Generation sind noch gar nicht absehbar.
Maja Strasser fasst das Dilemma prägnant zusammen: “Die Gutachter verstehen die Krankheit in den meisten Fällen nicht.” Diese Unwissenheit hat verheerende Konsequenzen für die Betroffenen. Sie führt zu falschen Einschätzungen, inadäquaten Behandlungsempfehlungen und letztendlich zu Entscheidungen, die das Leben schwer kranker Menschen zusätzlich belasten.
Die Belastungsintoleranz – das zentrale Symptom schwerer Long Covid-Verläufe – bleibt in den Gutachten unberücksichtigt. Dabei ist gerade dieses Symptom entscheidend für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit. Wenn ein Mensch nach geringster Anstrengung tagelang oder wochenlang in einen Zustand extremer Erschöpfung fällt, ist normale Erwerbstätigkeit unmöglich. Doch diese Realität findet in den IV-Verfahren keinen Niederschlag.
Die Ironie ist bitter: Während die medizinische Forschung längst erkannt hat, dass Long Covid und ME/CFS schwerwiegende neurologische Erkrankungen sind, hinkt die administrative Realität Jahre hinterher. Betroffene werden Opfer dieser Zeitverzögerung zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und bürokratischer Umsetzung.
Ein besonders perfides Element des Systems ist die Art, wie Mitwirkungspflichten eingesetzt werden. Betroffene werden zu Therapien verpflichtet, die ihrem Krankheitsbild nicht entsprechen oder sogar schaden können. Aktivierungstherapien, die bei Depression sinnvoll sein mögen, können bei ME/CFS-Patienten zu irreversiblen Verschlechterungen führen. Dennoch werden diese Therapien als Bedingung für Leistungen verlangt – ein Teufelskreis, der die Betroffenen in eine unmögliche Situation bringt.
Die Wartezeiten sind nicht nur ein administratives Problem, sondern eine humanitäre Katastrophe. Während Menschen wie Miriam Hürster seit über zwei Jahren auf einen Gutachtertermin warten, verschlechtert sich ihr Gesundheitszustand kontinuierlich. Die Ungewissheit über die finanzielle Zukunft verstärkt den Stress und kann die Symptome verstärken. Es ist ein Teufelskreis: Je länger die Verfahren dauern, desto kränker werden die Betroffenen.
Ausblick: Was muss sich ändern?
Die Forderungen der Experten sind klar: Die IV muss ihre Gutachterprozesse für Long Covid und ME/CFS grundlegend überarbeiten. Es braucht spezialisierte Gutachter, die das Krankheitsbild verstehen, angepasste Untersuchungsmethoden und vor allem die Anerkennung der Belastungsintoleranz als zentrales Symptom.
Die Lösung liegt nicht nur in besseren Gutachten, sondern in einem fundamentalen Paradigmenwechsel. Das derzeitige System basiert auf der Annahme, dass Krankheit messbar und objektiv bewertbar ist. Long Covid und ME/CFS sprengen diese Annahmen. Hier sind neue Ansätze gefordert, die der Komplexität und Variabilität dieser Erkrankungen gerecht werden.
Internationale Erfahrungen zeigen, dass andere Länder bereits weiter sind. In Norwegen beispielsweise werden ME/CFS-Patienten nach anderen Kriterien begutachtet, die der Realität der Erkrankung besser entsprechen. Deutschland hat begonnen, Long Covid als eigenständiges Krankheitsbild anzuerkennen. Die Schweiz hinkt hinterher und verschwendet dadurch nicht nur Ressourcen, sondern verursacht auch unnötiges Leid.
Darüber hinaus müssen die Verfahrensdauern drastisch verkürzt werden. Menschen, die schwer krank sind, können nicht jahrelang auf Entscheidungen warten, während ihre finanzielle Situation sich verschlechtert und ihre Gesundheit weiter leidet. Es braucht Eilverfahren für schwere Fälle und eine Beweislastumkehr: Nicht die Betroffenen müssen ihre Arbeitsunfähigkeit beweisen, sondern die IV muss begründen, warum sie Leistungen verweigert.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Schulung der Gutachter. Solange diese nicht verstehen, was Long Covid und ME/CFS bedeuten, werden ihre Einschätzungen unbrauchbar bleiben. Es braucht Fortbildungen, die auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand basieren und die Realität der Betroffenen widerspiegeln.
Die gesellschaftlichen Kosten des derzeitigen Systems sind enorm. Wenn produktive Menschen durch eine Erkrankung aus dem Arbeitsleben gerissen werden und dann zusätzlich durch bürokratische Hürden entmutigt und finanziell ruiniert werden, ist das volkswirtschaftlicher Unsinn. Eine frühzeitige, angemessene Unterstützung wäre nicht nur menschlicher, sondern auch kosteneffizienter.
Die Pandemie hat gezeigt, wie schnell sich gesellschaftliche Prioritäten ändern können, wenn der politische Wille vorhanden ist. Jetzt ist es Zeit, die gleiche Entschlossenheit für die Langzeitfolgen von Covid-19 aufzubringen. Long Covid wird nicht verschwinden – im Gegenteil, mit jeder neuen Infektionswelle kommen neue Betroffene hinzu.
Bei ichbinkeineinzelfall.ch verstehen wir die Frustration und Verzweiflung der Betroffenen nicht nur aus der Ferne – wir sind selbst in genau diese Falle getappt. Auch wir warten seit Jahren auf die IV, erleben am eigenen Leib, wie das System versagt und Menschen durchs Raster fallen lässt. Nach einem aktiven Leben wurden wir durch Long Covid und ME/CFS aus der Bahn geworfen und finden uns nun in einer Situation wieder, in der wir trotz jahrelangen Krankseins und völliger Arbeitsunfähigkeit nicht die Unterstützung erhalten, die wir so dringend brauchen würden.
Genau aus dieser existenziellen Not heraus ist diese Plattform entstanden. Aus der Erfahrung, dass man als Betroffener allein gegen Windmühlen kämpft, dass niemand versteht, was man durchmacht, und dass das System einen im Stich lässt, wenn man es am meisten braucht. Wir haben erlebt, wie es ist, wenn nach Jahren des Wartens immer noch kein Ende in Sicht ist, während die finanziellen Reserven schwinden und die Verzweiflung wächst.
Diese persönliche Betroffenheit macht uns nicht nur zu Fürsprechern für andere, sondern zeigt auch, dass jeder in diese Situation geraten kann. Wir waren einmal produktive Mitglieder der Gesellschaft, haben gearbeitet, Steuern gezahlt, in die Sozialversicherungen eingezahlt – und sind trotzdem durchs Raster gefallen. Wenn es uns passieren kann, kann es jedem passieren.
Unsere Mitgliedschaftsoptionen bieten nicht nur eine Plattform für den Austausch, sondern auch die Möglichkeit, gemeinsam für bessere Bedingungen zu kämpfen. Denn nur durch Solidarität und gemeinsames Handeln können wir ein System verändern, das derzeit viele im Stich lässt.
Die Erfahrung zeigt: Einzelne Betroffene haben gegen die Mühlen der Bürokratie kaum eine Chance. Aber gemeinsam können wir Druck aufbauen, Aufmerksamkeit schaffen und Veränderungen bewirken. Jede Geschichte, die erzählt wird, jeder Fall, der öffentlich wird, trägt dazu bei, das Bewusstsein zu schärfen und das System zu verändern.
Die Geschichten von Miriam, Nicole, Marco und vielen anderen zeigen: Es geht nicht nur um Geld oder Renten. Es geht um Würde, um Anerkennung des Leidens und um die Möglichkeit, trotz schwerer Krankheit ein menschenwürdiges Leben zu führen. Das sollte in einem reichen Land wie der Schweiz eine Selbstverständlichkeit sein – ist es aber offensichtlich nicht.
Die Realität sieht anders aus: Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet und in die Sozialversicherungen eingezahlt haben, werden im Krankheitsfall allein gelassen. Sie müssen nicht nur gegen ihre Krankheit kämpfen, sondern auch gegen ein System, das sie nicht versteht und oft nicht anerkennt. Das ist nicht nur inhuman – es ist auch gesellschaftlich und wirtschaftlich kurzsichtig.
Denn Long Covid wird uns noch lange beschäftigen. Die Zahl der Betroffenen steigt kontinuierlich, und mit jeder neuen Infektionswelle kommen neue Fälle hinzu. Wenn das System jetzt nicht umsteuert, werden die Probleme exponentiell wachsen. Es braucht dringend einen Paradigmenwechsel – von der Verweigerungshaltung hin zu echter Hilfe und Unterstützung für die Betroffenen.
Die Zeit drängt. Jeder Tag, an dem das System nicht reformiert wird, bedeutet für hunderte von Menschen weitere Monate oder Jahre des Leidens. Es ist Zeit zu handeln – für die Betroffenen von heute und für alle, die morgen erkranken könnten. Denn am Ende könnte es jeden treffen.
Dieser Artikel basiert auf dem SRF-Bericht “Long-Covid-Betroffene erheben schwere Vorwürfe gegen die IV” vom 20. Februar 2024. Die medizinischen Informationen ersetzen nicht die professionelle Beratung durch einen Arzt. Bei anhaltenden gesundheitlichen Problemen wenden Sie sich bitte an einen Mediziner.



